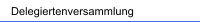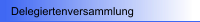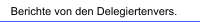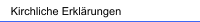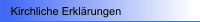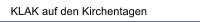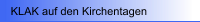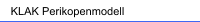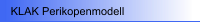Der neue KLAK-Vorstand
Alle drei Jahre wählt die KLAK ihren Vorstand neu. In diesem Jahr waren 17
landeskirchliche Arbeitskreise vertreten und nahmen an der Wahl teil. Dem
Vorstand gehören folgende Pfarrerinnen und Pfarrer an:
Vorsitzender: Dr. Michael Volkmann, Württemberg; Schriftführerin: Barbara
Eberhardt, Bayern; Schatzmeister: Heinz Daume, Kurhessen-Waldeck;
weitere Vorstandsmitglieder: Manon Althaus, Berlin-Brandenburg-
Schlesische Oberlausitz; Gabriele Zander, Hessen-Nassau, und Martin Pühn,
Bremen.
Impuls und Diskussion zur Lage in Nahost
Vor einem Jahr beschlossen die KLAK-Delegierten nach einer kontroversen
Diskussion über das 60. Jubiläum des Staates Israel (siehe Ölbaum online
Nr. 29/3., letzter Abschnitt), alljährlich bei der Delegiertenversammlung sich
über die aktuelle Lage in Nahost auszutauschen. Wie notwendig dieser
Beschluss war, zeigte sich bereits bei seiner erstmaligen Verwirklichung: der
Krieg in Gaza war noch im Gang. Darum hatte zunächst jede/r Delegierte
Gelegenheit sich zu äußern, bevor Pfarrer Dr. Tobias Kriener, Düsseldorf,
sein Impulsreferat „Zur Lage in Nahost“ hielt. Tobias Kriener ist in Beirut
geboren und kam mit acht Jahren nach Deutschland. Er lebte über drei
Jahre in Israel und gehörte von 1988 bis 2004 dem Deutsch-Israelischen
Arbeitskreis für Frieden im Nahen Osten (DIAK) an. Als Mitverfasser des
Buches „Kleine Geschichte des Nahostkonflikts“ sagt er heute, er sei des
Konflikts überdrüssig und leiste sich den „Luxus der Nichtinvolviertheit“; der
Krieg in Gaza habe ihn kalt gelassen. Die Schuldfrage sei uninteressant,
wichtig seien diplomatische Initiativen, aber eine Lösung sehe er definitiv
nicht. Er wolle in seiner Beschäftigung mit der Lage in Nahost immer wieder
neue Differenzierungen entdecken und halte es für gut, wenn man nach der
Diskussion ein gutes Stück verwirrter nach Hause fahre.
Krieners These lautete, das zionistische Projekt war erfolgreich und werde
erfolgreich bleiben. Der Zionismus sei die zeitgemäße Reaktion auf die Not
der Juden Europas gewesen, gegeben am falschen Ort: in Nahost, wo die
europäische „Judenfrage“ nicht verstanden und das zionistische Projekt
nicht akzeptiert werde. Die zionistische Bewegung habe ihre Position aber
immer neu adaptiert und immer auf der „richtigen“ Seite gestanden (Briten,
USA), die Araber bzw. Palästinenser hingegen auf der „falschen“
(Nazideutschland, Ostblock, Saddam Husseins Irak und seit dem 11.9.2001
auf der Seite des Terrors). Israel bereite sich jetzt bereits auf die künftig zu
erwartende „Mehrpolarität“ zwischen den USA und den aufstrebenden
Mächten Indien und China vor, während die Palästinenser auch in dieser
Beziehung zurück blieben. Israel siege immer weiter gegen immer
schwächer werdende Gegner, jedoch ohne seine Träume zu gewinnen.
Vielmehr seien weitere Waffengänge zu erwarten. Israel werde aber auch in
Zukunft seine Politik erfolgreich anpassen. Der Vortrag regte eine
differenzierte Diskussion an. Obwohl in der KLAK unterschiedliche Positionen
vertreten sind, war der Abend nicht von Kontroversen, sondern vom
gemeinsamen Wunsch nach mehr Verständnis geprägt.
Zum Tagungsthema „Der Gebrauch heiliger Schriften im Gottesdienst ...“
Seit drei Jahren drehen sich die Themen der KLAK-Tagungen um den
Gottesdienst. Ein von den Delegierten vor zwei Jahren eingesetzter
Ausschuss erarbeitet einen völlig neuen Entwurf für eine Reform der
Ordnung der Predigttexte. Leitend dabei ist die schon öfter (z. B. von
Dietrich Bonhoeffer, später von der Evangelischen Kirche im Rheinland u.a.)
aufgestellte Forderung nach mehr Predigttexten aus dem Alten Testament,
der Hebräischen Bibel. Der Ausschuss legte der Delegiertenversammlung
den bislang erarbeiteten Plan zur Kenntnisnahme und eingehenden internen
Diskussion vor. Die Delegierten ermutigten ihre Kolleginnen und Kollegen im
Ausschuss sehr, den Entwurf zu vollenden. Der Ausschuss plant, sein
Arbeitsergebnis noch in diesem Jahr zu veröffentlichen. In enger Verbindung
zu diesem Perikopenprojekt lautete das Tagungsthema 2009: „Der Gebrauch
heiliger Schriften im (evangelischen, katholischen, jüdischen) Gottesdienst
und das ihm zugrunde liegende Schriftverständnis“. Den evangelischen
Vortrag hielt Dr. Alexander Deeg, Universität Erlangen; den katholischen
Beitrag gab Prof. Dr. Heinz-Günther Schöttler, Universität Regensburg; und
das Referat aus jüdischer Sicht trug Rabbiner Prof. Dr. Andreas Nachama
von der Synagoge Hüttenweg in Berlin bei.
Dr. Alexander Deeg setzte mit Martin Luthers relationalem Verständnis
heiliger Schriften ein: ihre Heiligkeit sei keine substanzielle Eigenschaft,
sondern hänge damit zusammen, wie man mit ihnen umgehe. Im
Gottesdienst dürfe man sie nicht bloß lesen, man müsse sie auch predigen.
Das Evangelium sei nicht „Schrift“, sondern „Wort“, das „im Schwange“
gehe, indem man es auslege. Deeg problematisierte im heutigen
Protestantismus eine Homiletisierung und eine Horizontalisierung des
Evangeliums. Mit Homiletisierung bezeichnete er einen Umgang mit dem
biblischen Text, der von rationaler Argumentation und diskursiver
Begründung geleitet ist. Der Gottesdienst werde Deutungshilfe, Sinngebung
zum Leben, Religion werde entritualisiert, die Bibel ein Mittel zur
Selbstdeutung des Menschen. Während Luther davon ausgegangen sei, dass
im Gottesdienst Gott selbst zu uns Menschen durch sein Wort rede
(Vertikale Gott-Mensch), werde im heutigen evangelischen Gottesdienst das
Evangelium unter den Feiernden kommuniziert und somit horizontalisiert.
Deeg wandte sich einerseits gegen das zu esoterische und transrationale
Gottesdienstverständnis etwa von Manfred Josuttis - Gottesdienst sei
„Grenzverkehr mit dem Heiligen“ - und fragt: Warum nicht mit Luther
schlicht „Reden mit Gott“? Hier drohe die Fetischisierung der heiligen
Schrift. Andererseits wandte er sich gegen die radikale Homiletisierung, die
etwa Theophil Müller (Bern) vertrete, der so sehr die Verständlichkeit eines
Textes zum Wesentlichen mache, dass alles Fremde am Bibeltext wegfalle.
Deeg verglich in Filmausschnitten Lesungen katholischer, orthodoxer und
evangelischer Christen sowie von Juden und stellte vier in der
gegenwärtigen homiletischen Literatur diskutierte Wege zur Inszenierung
der Lesung vor: einen asketischen, einen intertextuellen, einen kreativen
und einen rituellen. Deeg selbst versteht die heilige Schrift als Basis des
Gottesdienstes: „Gottesdienst feiern heißt: einwandern in die Worte, Bilder
und Geschichten der Bibel“. Gottesdienst sei Gott-Mensch-licher
Wortwechsel, im Abendmahl bewohnten wir intensiv die heilige Schrift und
würden in den Worten der Bibel heimisch werden.
Ganz anders ging Rabbiner Prof. Dr. Andreas Nachama das Thema an. Er
erzählte von den gottesdienstlichen Problemen seiner liberalen Gemeinde.
Die Menschen kämen eher zum Sabbatempfangsgottesdienst am Freitag
Abend als zum Samstagfrühgottesdienst mit Toralesung. Viele empfänden
eine aus bis zu sieben biblischen Kapiteln bestehende Parascha (Lesung) als
zu lang und suchten nach Möglichkeiten, die Texte zu kürzen und besser zu
verstehen. Der Referent gab einen Überblick über die zur Lesung
kommenden Texte und beschrieb den extrem inszenierten Umgang mit
ihnen. Als besonders wichtig bezeichnete er die vielfältigen Möglichkeiten
der Gemeinde zu partizipieren. So schaffe der Rabbiner einen „persönlichen
Anker“ der Einzelnen in der Tora. Nachama erklärte die vier traditionellen
Auslegungsmethoden (Pschat, Remes, Drasch und Sod) und erzählte, wie er
es mit Lesung und Predigt über den gelesenen Text halte. Der Sinn der
Toralesung, so Nachama, sei, dass sie Weisung zum Leben gebe.
Entscheidend sei daher der Zusammenhang von Lesen, Hören und
Verstehen. In der Diskussion erläuterte Nachama Unterschiede liturgischer
Traditionen zwischen den verschiedenen Richtungen im Judentum und
verwies uns Christen besonders auf das erstaunliche Geschehen, dass mit
der teilweise messianischen Chabad-Lubawitsch-Bewegung aus der
jüdischen Gemeinde heraus eine neue Religion entstehe.
Prof. Dr. Heinz-Günther Schöttler sorgte mit seinem Vortrag am letzten
Abend für einen temperamentvollen und inhaltlich gewichtigen Schlusspunkt
der Tagung. Zuerst erklärte er uns die römisch-katholische Leseordnung, die
seit dem Vaticanum II gelte. Es gebe drei Lesejahre, eines mit Texten des
Alten Testaments für jeden Sonntag, eines mit Bahnlesungen der
Evangelien, und dazwischen ein Jahr mit Bahnlesungen aus dem Corpus
Paulinum. Die Texte seien zerstückelt und neu zusammengesetzt (die AT-
Lesungen sind im Durchschnitt fünfeinhalb Verse lang). Oft würde eine der
drei pro Gottesdienst vorgesehenen Lesungen wegfallen, meist der
Paulustext. „Wir stellen uns die Bibel zusammen, die wir haben wollen und
die uns mundet,“ sagte der Referent kritisch. Drei hermeneutische Modelle
stünden hinter diesem Umgang mit der Schrift: das simpel verstandene
Schema von Verheißung und Erfüllung, ein christologisch-typologisches
Verstehensmodell und das assoziative Stichwortprinzip. Sodann berichtete
Schöttler von Ideen, die es unter katholischen Liturgiewissenschaftlern für
eine Revision, Modifizierung oder wenigstens Optimierung der Leseordnung
gibt. Schließlich stellte er uns seinen eigenen Vorschlag für eine Reform der
römisch-katholischen Leseordnung vor, fügte aber hinzu, dass er keine
Chance auf Realisierung seines Vorschlags sehe. Der Vorschlag ist
bestechend gut durchdacht. Sein Grundanliegen ist eine weitest mögliche
Beibehaltung der Kanongestalt der biblischen Bücher. Es soll vier Lesejahre
geben, in jedem soll ein Evangelium in Bahnlesungen vorgetragen werden.
Den Evangelienlesungen sollen Toralesungen zugeordnet sein, und zwar so,
dass in jedem Jahr andere Texte aus allen fünf Büchern der Tora gelesen
würden. Wichtig sei vor allem, das Ende der Tora in jedem Jahr wieder mit
dem Anfang zu verbinden, denn nach diesem Prinzip seien auch die
Evangelien verfasst. Die Fortsetzung von 5. Mose 34 sei nicht Josua,
sondern 1. Mose 1. Analog sei die Fortsetzung des Lukasevangeliums nicht
die Apostelgeschichte, sondern sein eigener Anfang – und so sei das bei
allen Evangelien. Propheten- bzw. Paulustexte ordnet er der Tora bzw. den
Evangelien nach. Die geprägten Zeiten (Advent/Weihnachten und
Passion/Ostern) unterbrächen diese Ordnung, ihre Texte würden nicht nach
dem Schema von Verheißung und Erfüllung, sondern von Verheißung und
Bestätigung (Römer 15,8: Christus hat die Verheißungen bestätigt)
ausgewählt. In der Diskussion dieses Entwurfs wurde klar, dass eine auf
Bahnlesungen basierende, am Festhalten der Kanongestalt der Texte
orientierte Ordnung nicht vereinbar ist mit dem Ordnungsprinzip, das in der
Evangelischen Kirche vorherrscht, nämlich einem thematisch gegliederten
Kirchenjahr, in dem jeder Sonntag sein besonderes Thema hat, das in
Wochenspruch, Wochenlied, Wochenpsalm und in der auf ein Thema
bezogenen Zusammenstellung der Predigttexte aus Altem Testament,
Evangelien und Episteln zum Ausdruck gebracht wird.
Besuch bei der Jüdischen Gemeinde Berlins
Für eineinhalb Stunden waren die Delegierten zu Besuch im Centrum
Judaicum in der Oranienburger Straße, um mit der Vorsitzenden der
Jüdischen Gemeinde Berlins, Lala Süßkind, und Rabbiner Walter Rothschild
zu sprechen. Im Gespräch ging es im Wesentlichen um drei
Themenbereiche: um die jüdische Gemeinde, ihre interreligiösen
Beziehungen und um ihre aktuelle Situation. Da ich das Gespräch
moderierte und nichts schriftlich aufzeichnete, hier nur eine kurze
Zusammenfassung. Zum dritten Punkt: Unsere Gesprächspartner zeigten
sich schockiert über den Antisemitismus und die Gewaltbereitschaft bei
antiisraelischen Demonstrationen in Berlin, Deutschland und ganz Europa
anlässlich des Gaza-Krieges. Bei vielen dieser Demonstrationen gehe es
nicht nur gegen Israel, sondern unterschiedslos gegen alle Juden. Zum
zweiten Punkt: Das Verhältnis zur katholischen Kirche wird auf offizieller
Ebene nach wie vor durch den Streit um die Karfreitagsliturgie belastet. Im
Alltag gibt es gute christlich-jüdische Beziehungen, viele Angebote des
Centrums werden von Nichtjuden in Anspruch genommen. Zum ersten
Punkt, der die meiste Gesprächszeit einnahm: Die Jüdische Gemeinde
Berlins ist die größte in Deutschland und wie die meisten eine
Einheitsgemeinde. Anders als bei den anderen orthodoxen
Einheitsgemeinden in Deutschland gibt es in der Berliner Einheitsgemeinde
mehrere gleichberechtigte religiöse Richtungen. Sechs Synagogen mit rund
12.000 Mitgliedern gehören zur Gemeinde: Pestalozzistraße, Rykestraße,
Fraenkelufer, Herbartstraße, Joachimstaler Straße und Oranienburger
Straße. Vier jüdische Gemeinschaften gehören nicht zur Einheitsgemeinde:
Chabad-Lubawitsch, Adass Jisrael, die Lauder-Stiftung und die Synagoge
Hüttenweg. Entsprechend dieser Vielfalt gibt es auch reichlich Spannungen
unter den rund 16.000 (manche sagen: 25.000) Berliner Juden, aber diese
sind – positiv betrachtet – auch Zeichen einer großen Lebendigkeit. Der Link
zur Jüdischen Gemeinde Berlin: http://www.jg-berlin.org/. Wikipedia-Infos:
http://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCdisches_Leben_in_Berlin. Und die
Berlin-Kontaktseite von haGalil: http://www.berlin-
judentum.de/adressen/index.htm.
Michael Volkmann in Ölbaum Nr. 37/2009