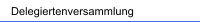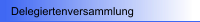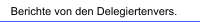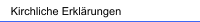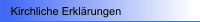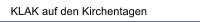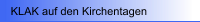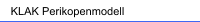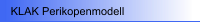„Gottesdienst feiern im Angesicht Israels“
lautete das Thema der diesjährigen Delegiertenversammlung der
„Konferenz landeskirchlicher Arbeitskreise ‚Christen und Juden’ im
Bereich der Evangelischen Kirche in Deutschland“ www.klak.org.
Einunddreißig Delegierte aus zwanzig Landeskirchen nahmen teil. Wir
hörten und diskutierten zum Tagungs-Thema drei Hauptvorträge sowie
einen Ausschussbericht und feierten Andachten und einen
Abendmahlsgottesdienst. Das Abraham-Geiger-Kolleg Potsdam und das
Projekt der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland
(ACK) „Weißt du wer ich bin?“ wurden vorgestellt, zwei Jubiläen - 30
Jahre KLAK und 50 Jahre Aktion Sühnezeichen Friedensdienste – wurden
begangen und eine lange Liste der KLAK-Geschäftsführung von mehr als
fünfzehn Tagesordnungspunkte durchgearbeitet. Vier Arbeitsgruppen
nahmen sich folgende Themen vor: 1) Die Arbeitshilfe der rheinischen
Kirche über die Erneuerung des Gottesdienstes, 2) Plan einer Reform der
Perikopenordnung (Ordnung der Predigttexte), 3) Kirchentag 2009 in
Bremen und 4) 60 Jahre Staat Israel. Außerdem kamen die vier
Regionalgruppen der KLAK zu separaten Sitzungen zusammen. Dank der
gründlichen Vorbereitung durch den Vorstand wurde die für die Tagung
zur Verfügung stehende Zeit optimal ausgenutzt. Im Folgenden gebe ich
eine kurze Zusammenfassung der Hauptreferate:
Dr. Irene Mildenberger, Leiterin des Liturgiewissenschaftlichen Instituts
der VELKD Leipzig , eröffnete den Diskurs mit der Frage nach „Kriterien
eines Gottesdienstes im Gegenüber zu Israel“. Lange Zeit, so die
Referentin, sei in der Kirche die Diskontinuität, die Antithese, der
Abbruch zwischen christlichem und jüdischem Gottesdienst betont
worden. Nichtwahrnehmung oder Überbietung des Judentums, die
Behauptung seiner Ersetzung oder Beerbung durch das Christentum
waren die Norm. Von Anfang an waren die Gottesdienste der Kirche
jedoch vom reichen Erbe der jüdischen Religion gespeist worden. Erst
„als jemand der Gedanke kam, dass Jesus Jude war“, so Gregory Dix,
wurde diese Erkenntnis zurück gewonnen, doch, so Mildenberger, sie
brauche eine lange Zeit um durchzudringen. Ein Beispiel: bis 1993 war in
der Bibliothek des Liturgiewissenschaftlichen Instituts Leipzig kein
einziges jüdisches Gebetbuch vorhanden. Neuere Forschung ergeben
folgendes Bild: Judentum und Christentum sind nebeneinander
entstanden. Vom 1. bis 3. Jahrhundert gab es in beiden, damals noch
nicht vollständig getrennten, Religionen eine große Vielfalt und
gegenseitige Beeinflussung. Auch nach der Besiegelung der Trennung
vom 4. Jahrhundert an setzte sich die wechselseitige Beeinflussung fort.
Heute erkennt die Kirche an: es gibt zwei unterschiedliche „Ausgänge“
der Hebräischen Bibel, die beide ihr Recht haben, den jüdischen und den
christlichen. Was für die Bibelauslegung zutrifft, kann auch für die
Liturgie gesagt werden: die Formen heutiger jüdischer und christlicher
Gottesdienste gehen auf den Gottesdienst im Jerusalemer Tempel
zurück. Am Beispiel von Ostern und Pessach führte Mildenberger aus,
wie eine solche Beeinflussung im Detail vorzustellen sei. Der israelische
Wissenschaftler Israel Yuval geht davon aus, dass „Pessach auf Ostern
reagiert“ habe. Am Schluss formulierte die Vortragende einige Kriterien
eines Gottesdienstes im Gegenüber zu Israel: 1. Im christlichen
Gottesdienst ist positiv und korrekt über Israel zu sprechen. 2. Das
Gebet ist Reden zu Gott, es ist nicht dafür geeignet, die Gemeinde zu
belehren. 3. Die eigene christliche Tradition hat ein Recht neben der
jüdischen. So muss man zwar nicht, kann aber ein Psalmgebet mit dem
trinitarischen „Ehre sei dem Vater“ abschließen. 4. Gemeinsamkeiten und
Berührungen von Judentum und Christentum sollen dankbar
wahrgenommen und bewusst gemacht (ausgesprochen) werden. 5. Auch
heute können Anregungen aus dem Judentum aufgenommen werden,
nicht jedoch in direktem Kopieren jüdischer Bräuche.
Dr. Alexander Deeg, Universität Erlangen , knüpfte an sein Referat vom
Januar 2007 an und sprach über „Das Abendmahl zwischen Opfervollzug
und Freudenfest“. Mit großem didaktischem und rhetorischem Geschick
präsentierte Deeg „etwas Kühnes“: Er diagnostizierte vier Probleme des
Abendmahls und empfahl als Therapie, die alle vier Probleme löse, den
christlich-jüdischen Dialog. Als erstes konstatierte Deeg eine Sinnkrise
des Abendmahls. Keine der aktuellen ritualtheoretischen oder ethischen
Deutungen erfasse Probleme und Chancen des Abendmahls voll.
Zweitens kehrten mit dem Angriff auf die Sühnopfer-Deutung des
Abendmahls – Jesus habe einen „neuen Gott“ gebracht, der keine Opfer
mehr brauche – marcionitische (antijudaistische ) Argumentationsmuster
in die Theologie zurück. Diese theologische Unsicherheit verleite drittens
dazu, die Event-Erfahrung bei der Feier des Abendmahls zu verstärken.
Und viertens gebe es die bekannten ökumenischen Probleme mit dem
Abendmahlsverständnis. Die Lösungen: Auf die Sinnfrage antwortet
Deeg mit dem hebräischen Opferbegriff qorban, der durch Buber und
Rosenzweig mit „Nahung“ bzw. „Darnahung“ verdeutscht werde. Ein
solches Verständnis besage: auf diesen Handlungsvollzügen liegt die
Verheißung der Nahung von Gott und Mensch. Göttliches und
menschliches Handeln im Abendmahl lassen sich nicht in
unterschiedliche Akte aufteilen. Nur der Vollzug („Solches tut!“) helfe
aus der Sinnkrise heraus. Zum zweiten Punkt brachte der Referent einen
Vergleich frühchristlicher Abendmahlstraditionen. Die Didache
(Gemeindeordnung, 2. Jh.) betone beim Abendmahl mit Bezug auf Israel
die Danksagung, durchgesetzt habe sich jedoch die paulinische
Auslegung der Feier zum Gedächtnis an Tod und Auferstehung Jesu.
Deeg warnte davor, den Danksagungscharakter des Abendmahls banal
und israelvergessen wiederzubeleben. Mit Hilfe des qorban-Begriffs
lassen sich Tod und Auferstehung Jesu als Eröffnung des Zugangs zu
Gott verstehen. Die Individualisierung des Sündopfergedankens und eine
Fixierung auf die Elemente Brot und Wein seien zu vermeiden. Im
Gesamtgeschehen des Abendmahls werde Gottes Handeln an uns allen
erfahrbar. Es könne verstanden werden als Dankesmahl in Erwartung der
Erlösung durch den wiederkommenden Herrn. Drittens riet der Referent,
das Abendmahl nicht als Event zu feiern, sondern es unspektakulär und
selbstverständlich zu tun – nicht zur Befriedigung eigener Bedürfnisse,
sondern im Einklang mit den unsagbaren Geheimnissen (Abraham
Joshua Heschel). Das vierte Problem, das ökumenische, sei zu lösen,
indem wir neu ansetzen und unser Verhältnis zum Judentum als die eine
große ökumenische Frage verstehen. Jesu Feier mit seinen Jüngern sei
eine jüdische Tischgemeinschaft gewesen. Mit Jesus sei beim Abendmahl
ein Jude gegenwärtig. Die endzeitliche Vision von Offenbarung 4
versammle in den 24 Ältesten (nach Deegs Deutung) die zwölf
Stammväter Israels mit den zwölf Aposteln der Kirche. In diese
Perspektive führe uns das Abendmahl.
Das dritte Hauptreferat hielt Dr. Detlef Dieckmann-von Bünau vom
Institut für Evangelische Theologie der Freien Universität Berlin über „Die
Bibel in gerechter Sprache“ (BigS). Dieckmann, der für die BigS das
Buch „Kohelet“ (Prediger) übersetzte, sprach über den christlich-
jüdischen Dialog als Hintergrund für diese Bibelübersetzung. Zunächst
erläuterte er in fünf Punkten die Übersetzungskriterien der „Bibel in
gerechter Sprache“: 1. Eine neue Übersetzung in Treue zum Originaltext,
2. Sie soll verständlich sein. Verständlichkeit und Texttreue sind die
beiden Grundkriterien, sie stehen in Konkurrenz zueinander. 3.
Sprachliche Fairness in Bezug auf die Geschlechter. 4. Respekt
gegenüber der jüdischen Lektüre. 5. Besonderes Augenmerk auf den
eigentlich unübersetzbaren und nach jüdischer Auffassung
unaussprechbaren Gottesnamen. Kaum eine andere Bibelübersetzung, so
der Referent, lege ihre Kriterien so ausführlich dar wie die BigS. Weiter
schaffe sie (im Unterschied etwa zur neu erschienenen, gemeinschaftlich
übersetzten Zürcher Bibel) durch Nennung von Namen Transparenz, wer
welches biblische Buch übersetzt habe. Viele Christen vergäßen über der
Lektüre der Lutherbibel oder anderer nur von einer Person übersetzten
Bibelausgaben, dass die Bibel viele verschiedene Verfasser und
unterschiedliche Sprachstile aus mehreren hebräischen Sprachepochen
habe. Dann kam Dieckmann auf die Reaktionen auf die BigS zu
sprechen. Diese seien überwiegend positiv. In Gruppengesprächen gäbe
es, wenn überhaupt, meist nur einen einzigen scharfen Kritiker pro
Gruppe. Die anderen Teilnehmer/innen näherten sich der BigS teils
skeptisch, teils interessiert, neugierig bis begeistert. Unter über
eintausend schriftlichen Reaktionen an Autorinnen und Autoren seien nur
zwanzig scharfe Kritiken oder Schmähungen. Bei Presseberichten sehe
es allerdings anders aus: positive und negative hielten sich die Waage.
In der Öffentlichkeit hätten einige wenige, prominent in Feuilletons
platzierte, vernichtende Reaktionen Aufsehen erregt. Manche von ihnen
kamen bereits vor Veröffentlichung der BigS und waren auf die
vorläufige Arbeitsversion des Textes bezogen. Manche der Kritiker
setzten ihr eigenes Textverständnis mit dem Urtext und dem Sinn der
Bibel gleich und fällten scharfe Urteile. Andere, die es nach eigener
Aussage nicht schon von vorn herein besser wüssten, neigten zu
differenzierter Analyse der BigS. Dieckmann sagte, er kenne (neben
einigen mündlichen Äußerungen) nur drei schriftliche Reaktionen
jüdischer Kritiker. Michel Bollag vom Zürcher Jüdischen Lehrhaus hielte
die BigS für ein „Zeichen der Umkehr und der Hoffnung“. In ihr werde
die jüdische Lektüre eben der heiligen Schriften zur Sprache gebracht,
die am 9.11.38 vernichtet werden sollte. Viviane Berg nenne die BigS
„ein gelungenes Werk“. Prof. Dr. Micha Brumlik schrieb in der Frankfurter
Rundschau von einem „neuen Kulturkampf“ um die alte antijudaistische
christliche Auslegung und die neue Paulusinterpretation der BigS.
Zusammengefasst seien Christinnen und Christen sehr kritisch, kritisch-
konstruktiv oder positiv zur BigS eingestellt, Jüdinnen und Juden längst
nicht so kritisch wie Christen. Die EKD habe eine Empfehlung
herausgegeben, die BigS nicht im Gottesdienst zu verwenden. Während
einige Landeskirche sich diese Empfehlung nicht zu eigen machten,
werde sie in anderen wie eine verbindliche Weisung von oben
verstanden. So habe sich die nordelbische Bischöfin Bärbel Wartenberg-
Potter bei einer Gottesdienstsendung mit der Ankündigung des EKD-
Rundfunkrats konfrontiert gesehen, sollte sie die BigS verwenden, werde
die Sendung abgeschaltet und eine Ersatzkassette eingelegt. Schon
lange nicht mehr sei so intensiv und ausdauernd über die Bibel, ihre
Übersetzung und Auslegung gestritten worden, so Dieckmann. Die
öffentliche Aufmerksamkeit habe zu mittlerweile 70.000 verkauften
Exemplaren in drei Auflagen des von Dieckmann lieber als „Gütersloher
Bibel“ bezeichneten Buches geführt. Inzwischen liege auch eine CD-
ROM-Ausgabe vor.
Schließlich war bei der KLAK der Rabbinerstudent Adrian Schell als
Referent zu Gast. Schell stellte das Potsdamer Abraham-Geiger-Kolleg
vor. Ohne die Geschichte des liberalen Judentums könne man die
Bedeutung dieser Einrichtung nicht verstehen, sagte er. Darum referierte
er diese Geschichte seit Beginn des 19. Jahrhunderts ausführlich.
Besonders die Berliner Hochschule für die Wissenschaft des Judentums
(1872-1943) hatte für das Geiger-Kolleg Vorbildfunktion. Für die
Gründung des Abraham-Geiger-Kollegs im Jahr 2001 war einerseits der
Bedarf aufgrund der jüdischen Einwanderung aus Osteuropa,
andererseits der Wunsch, auch Frauen zum Rabbineramt auszubilden,
maßgebend. Das Institut ist Mitglied in der Weltunion für Progressives
Judentum, es kooperiert mit der Universität Potsdam, dem Institut
Machon in Moskau und den Hebrew Union Colleges (HUC) in Cincinnati
und Jerusalem. Sehr gute Verbindungen bestehen auch zur Freien
Universität Berlin und zur Fakultät für Katholische Theologie der
Universität Bamberg. 2008 studieren 17 Männer und Frauen auf das Ziel
des Rabbinerberufes hin. Sie belegen an der Universität Potsdam die
Fächer Jüdische Studien und Religionswissenschaft und studieren dort
unter 300 bis 400 nichtjüdischen Studierenden. Das Abraham-Geiger-
Kolleg ergänzt dieses Studium durch Kurse nach dem Curriculum des
HUC in Cincinnati.
Noch interessanter als sein Vortrag schon war, war das nachfolgende
Gespräch mit dem Referenten. Es war, als sprächen wir mit einem längst
vertrauten Menschen über etwas, das uns zugleich bekannt, dem
Studium der Theologie ähnlich, und doch auch fremd erscheint, eben
eine Rabbinerausbildung. „Wir leben den christlich-jüdischen Dialog
eigentlich jeden Tag an der Uni“, erzählt Schell. Er selbst hat 30
Semester-Wochenstunden belegt. Montags, Dienstags und Mittwochs
studiert er an der Uni Potsdam, von Mittwoch Abend bis Freitag Mittag
am Abraham-Geiger-Kolleg. Er lernt biblisches und heutiges Hebräisch,
Chasanut (praktische Gestaltung der Liturgie und des Gottesdienstes),
Liturgiegeschichte, practical rabbinics (jüdische Feste) und Philosophie
und bekommt eine psychologische Supervision bzw. Gesprächs-
Ausbildung durch eine evangelische Theologin. Die Inhalte der Seelsorge
werden mit dem zuständigen Rabbiner besprochen. Auch das
interreligiöse Gespräch zwischen Juden, Christen und Muslimen wird am
Geiger-Kolleg sehr ernst genommen. Die Studierenden arbeiten bereits
während des Studiums einmal pro Monat ein Wochenende lang in einer
Praktikumsgemeinde, geben Bar-Mizwa-Unterricht, halten in
Personalunion von Rabbiner und Kantor Freitagabendgottesdienste,
machen am Sabbat die Toralesung mit auslegender Predigt, danach den
Kiddusch (Imbiss), außerdem geben sie Toraunterricht und führen
Einzelgespräche. Im Vergleich zur Theologenausbildung bedeutet das:
das Vikariat ist bereits ins Studium integriert. Demnächst wird er für ein
Jahr am HUC Jerusalem studieren. Nach der Ordination zum Rabbiner
wird er eine eigene Gemeinde übernehmen.
Nicht von sich aus, sondern durch eine Frage aus dem Delegiertenkreis
der KLAK dazu aufgefordert, berichtete Schell von den Aktivitäten so
genannter messianisch-jüdischer Missionare auf dem Campus in
Potsdam. Diese missionierten unter den wenigen jüdischen Studierenden
ohne Respekt und Toleranz. Sie griffen die aus der kommunistischen
Vergangenheit resultierende Angst der überwiegend russischen
Einwanderer, Jude zu sein, auf und versprächen ihnen, durch die Taufe
vor Verfolgung geschützt zu sein, weil sie dann keine Juden mehr seien.
So jedenfalls kommt es laut Schell bei den Betroffenen an.
Die KLAK erklärt in ihrer Satzung: Judenmission lehnen wir ab.
Eine Arbeitsgruppe der KLAK beschäftigte sich in Berlin mit dem
aktuellen Thema „60 Jahre Staat Israel“. Im Plenum kam es dann über
die Frage, ob die KLAK aus diesem Anlass öffentlich Freude bekunden
solle, zu einer kontroversen Diskussion. Da ich vermute, dass uns solche
Diskussionen während des ganzen Jubiläumsjahres begleiten und wir, so
hoffe ich, voneinander lernen werden, möchte ich das Thema am Schluss
dieses Briefes noch nicht weiter vertiefen, sondern zunächst auf zwei
interessante Links des Reformierten Bundes in Deutschland hinweisen,
für die ich der wissenschaftlichen Mitarbeiterin des Reformierten Bundes
Barbara Schenck danke:
Christlich-jüdischer Dialog und deutsch-israelische Beziehungen
60 Jahre Staat Israel
Michael Volkmann in Ölbaum Nr. 28/2008