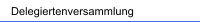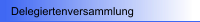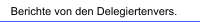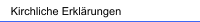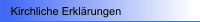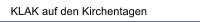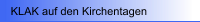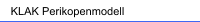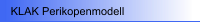Lorem ipsum dolor sit amet

Bericht von der KLAK-Jahrestagung 15.-18.1.2016 in Berlin
zum Thema „Bausteine einer nicht antijüdischen
reformatorischen Theologie“
„Bausteine einer nicht antijüdischen reformatorischen Theologie“
lautete das Thema der Jahrestagung der Konferenz landeskirchlicher
Arbeitskreise „Christen und Juden“ (KLAK) vom 15-18. Januar 2016 in
Berlin. Es sollte nicht um Martin Luther und die Juden gehen, sondern
um eine seit langem wiederholt geäußerte, zuletzt in der EKD-
Kundgebung über Martin Luther und die Juden vom 11.11.2015
ausgesprochene Forderung: „Wir stellen uns in Theologie und Kirche
der Herausforderung, zentrale theologische Lehren der Reformation neu
zu bedenken und dabei nicht in abwertende Stereotype zu Lasten des
Judentums zu verfallen. Das betrifft insbesondere die Unterscheidungen
‚Gesetz und Evangelium‘, ‚Verheißung und Erfüllung‘, ‚Glaube und
Werke‘ und ‚alter und neuer Bund‘.“
(http://www.ekd.de/synode2015_bremen/beschluesse/s15_04_iv_7_ku
ndgebung_martin_luther_und_die_juden.html) Die Tagung zeigte, dass
dieses Neubedenken ein langer, arbeitsreicher Weg sein wird. Hier eine
Zusammenfassung auf der Basis meiner Aufschriebe, also von den
Referenten nicht autorisiert:
Peter von der Osten-Sacken, emeritierter Professor für Neues
Testament und langjähriger Leiter des Instituts Kirche und Judentum
Berlin, behandelte das Thema ausgehend von Luthers Judenschriften in
sechs Schritten:
1. Die zentrale Bedeutung des Alten Testaments für, über und gegen die
Juden bei Martin Luther zeige sich schon in der Schrift von 1523 „Dass
Jesus Christus ein geborener Jude sei“, in der er einen neuen,
freundlichen Umgang mit Juden fordere. Diese Schrift Luthers sei
größtenteils Schriftauslegung. Luther ließe nur eine Auslegung des
Alten Testaments durch das Neue Testament zu. Seine Schriften von
1543 diabolisierten jüdische Schriftauslegung als eine Gefährdung der
Kirche und seines eigenen Glaubens. Die tiefste Wurzel seines
Judenhasses sei sein eigenes Angefochten sein. Ihm setze er sein sola
fide und sola scriptura entgegen, verbunden mit dem Aufruf zur
Gewaltanwendung gegen Juden. Das bedeute theologische
Schwerarbeit für uns.
2. Anhand von Luthers Auslegung von Genesis 22 und Genesis 32
zeigte der Referent das Alte Testament als Buch des Trostes und Martin
Luther als Theologen des Trostes: „Luther at his best“.
Zu Gen. 22, der Geschichte von der Bindung Isaaks: Bis es zum
Selbstwiderspruch Gottes (v. 12 gegen v. 2) komme, gehe Abraham
einen Weg, der höher sei als alle Vernunft, denn er gehorche ohne zu
zweifeln. Sein Glaube, so Luther, gleiche dem Auferstehungsglauben,
im Zentrum stehe das Vertrauen in die Verheißung, die Geschichte
werde uns zum Trost erzählt.
Zu Gen. 32, dem nächtlichen Ringkampf Jakobs am Jabbok: Jakobs
Worte „Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn“ deute Luther als
großen Glauben. Jakobs Gegner sei nach Luther der dreieinige Gott. Die
Stärke von Luthers Auslegung sei, dass sie sage, ein gläubiger Mensch
könne Gott überwinden, wo er in anderer Gestalt erscheine: Gott habe
geschworen/ verheißen, er wolle dein Gott sein – so halte fest am Wort:
mit Gott gegen Gott. Verheißung bleibe in Kraft als bewegende Kraft
des Glaubens. Luther, so der Referent, tue diesen Texten keine Gewalt
an und zeige sich in ihrer Auslegung als großer Theologe des Trostes.
Dies sei bei Luther von Text zu Text zu prüfen.
3. Luther als Theologe des Gesetzes, so der Referent, unterscheide
zwischen „Gesetz“ als jüdischem Rechtsbuch und „Gesetz“ für alle
Menschen, etwa in den Zehn Geboten. „Gesetz“ für alle Menschen
werde zweifach gebraucht: theologisch bezogen auf den Menschen als
Sünder, Feind Gottes und seinen Wahn, aus sich selbst heraus vor Gott
bestehen zu können; politisch bezogen darauf, dass der Mensch der
Bestie in sich nicht freien Lauf lassen solle. Das Gesetz überführe den
Menschen und treibe ihn zum Evangelium, es sei also Teil eines
heilvollen Geschehens. Theologiegeschichtlich durchgesetzt habe sich
jedoch die Sicht auf das Gesetz als Gegensatz zum Evangelium. Zudem
seien die beiden Begriffe mit den gleichnamigen Büchern gleichgesetzt
worden, obwohl Luther es anders gemeint habe. Diese theologische
Verwendung des Gesetzesbegriffs sei eine Engführung auf den
Einzelnen und sein Heil. Tatsächlich zeige das Gesetz positiv auf den
Nächsten, weit über bürgerliche Pflichterfüllung hinaus.
Darum plädierte der Referent für einen usus legis empathicus, für
Gebote als Weisung für ein Leben in Übereinstimmung mit dem Willen
Gottes. Als Weisung zu einem Blick nicht auf die eigene Not, sondern
auf die Not der Anderen. Das höchste Gebot, die Nächstenliebe, liebe
Freund und Feind. „Gott nimmt dich an, wie du bist, und er will etwas
von dir: Umkehr, Verwandlung, Neuschöpfung, dem Nächsten zugute“.
4. Luther als Theologe der Hoffnung. Römer 9-11 ist der einzige Text im
Neuen Testament über Israel im Licht des Evangeliums. Die drei Kapitel
mit ihrer zentralen Aussage „Israel bleibt erwählt“ sind Grundlage eines
neuen Verhältnisses zum Judentum. Luther habe diese Sicht auf Israel
nur kurze Zeit (1523) geteilt und dann geschwankt. Römer 9-11 sei
nicht nur Baustein, sondern Eckstein einer nicht antijüdischen
reformatorischen Theologie.
5. Ein neuer Ansatz im Umgang mit dem Alten Testament. Für Luther
sei der Streit zwischen Christen und Juden ein Streit um das rechte
Schriftverständnis gewesen. Hier müssten wir über Luther hinausgehen
und den jeweiligen wörtlichen Schriftsinn nach christlicher und nach
jüdischer Auslegung einander gegenüberstellen, dazu einen sensus
dialogicus. „Wenn das Neue Testament durch menschlichen Verstand
ausgelegt werden könnte ohne das Alte Testament, dann wäre das
Neue Testament umsonst gegeben.“ Altes und Neues Testament seien
nebeneinander auf Augenhöhe zu sehen. Das AT sei als
Herausforderung an das NT zu lesen: Was ist alles nicht eingelöst? Was
ist liegen geblieben? Man müsse heraus aus dem Denken des
„Überwundenen“.
6. Der Wahrheitsanspruch des Christentums ist in Frage gestellt.
Christentum und Judentum bezeugten zwei Wahrheitsgewissheiten.
Biblisch stehe Wahrheit für die Wirklichkeit Gottes, an ihr hätten zwei
Religionen teil. Der Streit darüber zwischen ihnen sei unnütz.
Entscheidend sei ihr jeweiliges Zeugnis im Wort, in der Tat, im Leben.
Evangelium und Tora flössen zusammen in 3. Mose 19,18: Liebe deinen
Nächsten dir gleich. Christentum bedeute: Gott will und braucht dich!
Und welchen Anspruch haben Juden an uns Christen? Dass wir sagen:
Wir wollen euch als Teil von uns, auch wenn ihr keine Christen werdet.
Heinrich Bedford-Strohm, Vorsitzender des Rates der Evangelischen
Kirche in Deutschland, sprach zum Tagungsthema in
kirchengestaltender Perspektive. Er grüßte die KLAK als „Think tank der
EKD zu theologischen Aspekten des christlich-jüdischen Verhältnisses“,
als „etwas ungeheuer Wertvolles“. Das Reformationsjubiläum 2017 solle
„ein großes Christusfest“ in ökumenischer Perspektive gefeiert werden,
da stelle sich die Frage des Tagungsthemas im Verhältnis zum
Judentum gerade. Nach einem kurzen Rekurs auf seine langjährige
persönliche Verbundenheit mit dem christlich-jüdischen Dialog und auf
die Aktualität der Barmer Theologischen Erklärung betonte der
Referent, wer Christologie wirklich ernst nehme, könne nicht anders,
als die bleibende Erwählung des Gottesvolkes Israel gleichzeitig stark
zu machen. Wer Christozentrik ernst nehme, müsse allen Antijudaismus
überwinden. Hinter das im Dialog mit dem Judentum Erarbeitete könne
niemand zurück wollen. In Konsequenz aus der Anerkennung der
bleibenden Erwählung Israels werde die EKD sich jetzt mit
Judenmission und dem Begriff des Zeugnisses beschäftigen. Auch zum
Thema Flüchtlinge müsse die Kirche Stellung beziehen und fragen: Wo
finden wir das, was wir mit Jesus Christus verbinden – sein Jude sein,
seine Aussage „Ich bin ein Fremder gewesen“ (Mt 25) – wieder? Wir
warten gemeinsam mit den Juden auf den Messias. In der
nachfolgenden Diskussion wurde vorgeschlagen, das
Reformationsjubiläum zugleich als Christusfest und als Sinaifest zu
feiern – denn das Nächstenliebegebot sei Tora vom Sinai.
Christoph Markschies, Professor für Kirchengeschichte an der Berliner
Humboldt-Universität und derzeitiger Leiter des Instituts Kirche und
Judentum, führte uns nicht nur durch das Institut, sondern trug zum
Tagungsthema einige Thesen in kirchenhistorischer Sicht bei. Martin
Luther sei zuerst und auf sehr gründliche Weise Bibelwissenschaftler
gewesen und habe unter immer größerer Zunahme seiner
Hebräischkenntnisse im Wesentlichen Altes Testament ausgelegt. Wir
müssten uns in anderer Weise als bisher wieder um biblische Texte
kümmern. Um Luther als Exegeten würdigen zu können, brauchten wir
mehr Forschung über die jüdischen Exegeten, die Luther studiert habe.
„Bausteine“ lege das Bild vom Steinbruch nahe, es komme jedoch
darauf an, Luther-Aussagen in ihrem Kontext wahrzunehmen. Luthers
Theologie gehe von konkreten Erfahrungssituationen aus und wende
sich vor allem gegen den Menschen, der sich selbst rühme. Folglich sei
die Haltung der Demut die einzig angemessene beim Theologie treiben.
Im Umgang mit dem Judentum komme nur eine Theologie in der
Haltung der Demut zu angemessenen Ergebnissen. Neben dem Grobian
Luther gebe es den feinsinnigen, ganz sensiblen Bibelausleger Luther.
Christian Link, emeritierter Professor für Systematische Theologie aus
Bochum, trug systematisch-theologische Bausteine zum Thema bei.
1. Die Baustelle: Das Neue Testament sei ohne das Alte Testament
nicht zu verstehen. Alles, was unsere Identität als Kirche ausmache, sei
Erbschaft Israels und mache uns zu Miterben. Ohne dieses Erbe lebten
wir ohne Gott in der Welt. Schon im NT (Matthäus 21,43; Hebräerbrief,
Jakobusbrief) werde Israel theologisch disqualifiziert und damit ein
zentraler Anspruch Jesu verdrängt. Mit den Juden seien Bund und Treue
Gottes aufgegeben und Gott angegriffen und verleugnet worden. Erst
eine christliche Schuldanerkennung, befördert durch Dietrich
Bonhoeffer und Karl Barth, habe zu dem dramatischen Wandel in den
christlich-jüdischen Beziehungen geführt, der im Dokument „Dabru
emet“ 2000 auch von jüdischer Seite gewürdigt werde. Einheit und
Ökumene der Kirche seien ohne Israel nicht denkbar, denn Christen
kämen immer nur hinzu zu Israel als Volk Gottes.
2. Unerledigte Probleme:
a) Unsere Identität – die Christusfrage: sie sei exegetisch und
dogmatisch ohne jüdischen Hintergrund nicht zu beantworten. Die
Kirche habe auf die Erfahrung der Auferstehung in der Sprache des
Alten Testaments und des Judentums reagiert. Diese Sprache sei nur im
Dialog zu lernen. Die systematische Arbeit müsse ansetzen bei der
Enterbungsthese, der Substitutionsthese, der Judenmission, der Lehre
von Jesus als dem, der uns von den Juden trennen sollte, und diese
Arbeit müsse abzielen auf eine Revision der traditionell verstandenen
Christologie und Trinitätslehre.
b) Der ungekündigte Bund: Der Rheinische Synodalbeschluss von 1980
mache die Neubesinnung sichtbar
http://www.ekir.de/www/downloads/ekir2008arbeitshilfe_christen_jude
n.pdf
http://www.ekir.de/www/downloads/ekir2005sonderdruck_christen_jud
en.pdf
Traditionelle Lutherische Theologie scheide zwischen Kirche und
Judentum, Gesetz und Evangelium, Verheißung und Erfüllung, und
vertrete die Enterbung. Wer das ändern wolle, müsse sich davon
verabschieden, nicht jedoch von Paulus, diesen dürfe man nicht nur zur
Hälfte rezipieren. Paulus laste den Konflikt im Menschen nicht der Tora,
sondern ihrem Missbrauch an, während Luther ihn dem „Gesetz“
anlaste. Mit Calvins Entwurf erfolge ein Perspektivwechsel. Darin seien
Gesetz und Evangelium nicht im menschlichen Konflikt, sondern von
Gott her dargestellt. Bei Calvin verbinde die Kategorie „Bund“ (die bei
Luther nicht vorgesehen sei) das Neue mit dem Alten Testament. Karl
Barth bezeichne die Erwählung Israels als Summe des Evangeliums.
Der Israelbund sei ungekündigt. Die Tora sei die Verfassung, die die
Institution des Bundes gültig mache und das Lebensverhältnis des
Bundes beschreibe. Das Neue Testament eröffne uns in Jesus Christus
dieses Lebensverhältnis. Calvin spreche Juden als Teilhaber der
Wahrheit Christi an und widerspreche ihrer Ausgrenzung.
c) Judenmission: Bezeichnend für die Situation nach 1945 sei gewesen,
dass die Sächsische Landeskirche in einem Schuldbekenntnis
Judenmission als „vornehmsten Beitrag“ gegen das an Israel
begangene Unrecht bezeichnet habe. Denn wie in den Jahrhunderten
davor sei man auch da noch von der Preisgabe des Alten Bundes
ausgegangen. Kein klassisches christliches Bekenntnis erwähne Israel,
geschweige denn würdige es theologisch. Das Judentum stelle an das
Christentum die Frage, wo Zeichen der Erlösung zu sehen seien. Israel
sei Partner einer Kirche, die ihrer Erfüllung erst entgegen gehe. Die
Niederländische Reformierte Kirche habe als erste den Fortschritt von
der Mission zum Dialog vollzogen: Gott habe für Israel Zukunft als Volk
der Verheißung und des Messias. 1973 habe die Französische
Bischofskonferenz erklärt, die Aufgabe Israels am Plan Gottes sei die
besondere Berufung zur Heiligung des göttlichen Namens, die Sendung
der Kirche sei nur im Rahmen der universalen Sendung Israels zu
verstehen. Die Rheinische Kirche erklärte, dass die Sendung der Kirche
zu Israel eine andere sein müsse als die zu den Völkern.
d) Die Revision der Christologie und der Trinitätslehre sei die
schwierigste Aufgabe, da hier die tiefste Kluft und Trennung bestehe.
Dieser sehr ausführliche und differenzierte Abschnitt in Anknüpfung an
die Theologien von Hans-Joachim Kraus, Jürgen Moltmann und
Friedrich-Wilhelm Marquardt kann hier nur in einigen Kernaussagen
wiedergegeben werden. Jesus Christus, so der Referent, sei nicht
voraussetzungslos. Zeitgenossen hätten ihn gefragt: „Bist du’s, der da
kommen soll?“ Nur wenn er im Erwartungshorizont Israels stehe, könne
er der sein, der da kommen soll. Er bringe und mit ihm komme der
„Name des Herrn“, nicht etwas Neues, sondern das alte „Immanuel“
(Gott bei uns). Mit Jesus werde das alte Buch neu aufgeschlagen. Er
erzähle Halacha, einen Weg, den Gott selbst mit uns gehe. Jesus trete
in das Namensgeheimnis Gottes ein, nicht an Gottes Stelle. In dem
Messias weilte Gottes Schechina („Einwohnung“) unter den Menschen.
Gott sei in Jesus gegenwärtig, Jesus werde nicht vergöttlicht, sondern
die Offenbarung gehe mit einer Selbstbescheidung Gottes einher.
Gottes Namen werde unterschieden von Gott selbst in seiner
Verborgenheit. Jesus Christus trete mit seiner Existenz in das
Geheimnis der Namensoffenbarung Gottes ein. Hier könne eine neue
Christologie ansetzen. Basis für eine Trinitätslehre könne Johannes
10,30 sein, „Ich und der Vater sind eins“ – „eins“, nicht „einer“. Also
(mit Calvin) keine personale Einheit, keine Wesenseinheit, sondern eine
funktionale Einheit, ausgesagt durch Handlungsbegriffe, die auf die
außergöttliche Wirklichkeit bezogen seien, auf die Einheit der Kirche als
Beglaubigung der göttlichen Einheit. Die trinitarische Einheit sei
eschatologisch, offen, auf Erfüllung wartend, noch unerfüllt.
Entsprechend sei das Eins werden der Gemeinde als ein in Zukunft
offener Prozess verstehbar zu machen. Ein Schlüssel zum Verständnis
der Trinität könne Jesu Aussage in Johannes 17,6 - „Ich habe deinen
Namen den Menschen offenbart“ - sein. Gottes Namen kämen zu Israel,
kämen in Jesus Christus, kämen im pfingstlichen Geist zu den Völkern.
Eine neue Trinität müsse dem Monotheismus Israels nicht länger
widersprechen.
Soweit die theologischen Hauptreferate der KLAK-Jahrestagung in
Zusammenfassung. Die KLAK wird am Thema „Bausteine einer nicht
antijüdischen reformatorischen Theologie“ weiterarbeiten.
Ölbaum online Nr. 94 – 23. Februar 2016 – Dr. Michael Volkmann
Evangelisches Pfarramt für das Gespräch zwischen Christen und Juden,
Bad Boll
Ölbaum online Ausgaben sind durch eine leere E-Mail mit dem Betreff
„Bestellung Ölbaum online“ an agwege@gmx.de anzufordern und unter
http://www.agwege.de/cms/startseite/oelbaum-online/ einzusehen.
Dort finden Sie auch ein Inhaltsverzeichnis aller Ausgaben seit Nummer
1.

Bericht Delegiertenversammlung 2016